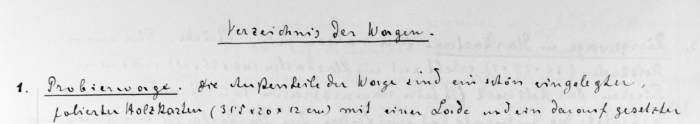
12 Seiten, fertiggestellt 1906-08-05
aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Juli 2017
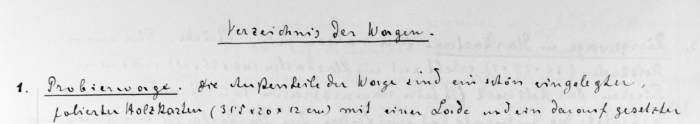
der historischen Sammlung des mathem. Turmes
P. F. S. 5. 8. 1906
Die Waagen
In Hinsicht auf die Beschreibung der einzelnen Waagen wollen wir, so weit es beim Stande der
Mechanik im 17. und 18. Jh. notwendig scheint, die leicht verständlichen Bezeichnungen der
wichtigsten Bestandteile anführen, ohne uns auf eine Erklärung einzulassen.
Unsere Sammlung enthält nur zweiarmige Waagen. Mit dem Waagebalken ist die Welle (Achse) in
fester Verbindung, die entweder direkt auf festen Lagern aufsitzt oder mit Schneiden
versehen ist, die sich in hohlen Pfannen aus Stahl, Achat oder Glas bewegen. An den Enden
der Waagebalken hängen meist an drei Schnüren die runden oder eckigen, an den Rändern
aufgebogenen Waagschalen; mitunter sind sie jedoch auf das Ende des Waagebalkens aufgesetzt.
Zur leichten Erkennung der Gleichgewichtslage ist senkrecht zum Waagebalken und zur Welle
eine Zunge angebracht; sie geht entweder nach oben und kommt zwischen die vertikal hängende
Schere zu liegen, die bei genaueren Waagen noch eine Gegenzunge trägt; oder die Zunge ist
nach abwärts gerichtet und spielt dann zuweilen über einem Gradbogen. Zur bequemeren Handhabung
und zugleich zur Schonung der Schneiden lässt sich entweder die ganze Waage senken, so daß
die Schalen auf dem Boden aufruhen, oder es wird die Schneide aus der Pfanne gehoben. Zum
Schutze gegen Staub und zur Vermeidung eines störenden Luftzuges schließt man feinere Waagen
in Glaskästen ein.
Von den vorhandenen Waagen sind die einen frei mit der Hand zu halten, andere sind aufzuhängen.
Da sie verhältnismäßig klein und schwach gebaut sind, dienen sie nur zum Wägen leichter
Gegenstände; für spezielle Zwecke eingerichtet sind eine Probierwaage, eine hydrostatische
Waage und mehrere Goldwaagen.
Den meisten Waagen sind Gewichtsstücke beigegeben. Da uns die alten Abteilungen der Gewichte
nicht geläufig sind, will ich die wichtigsten, soweit sie hier im Gebrauch waren, anführen.
Ein Apothekerpfund á 12 Unzen, á 8 Drachmen, á 3 Skrupel, á 20 Gran.
Ein österreichisches Pfund á 32 Lot, á 4 Quentchen.
1 Unze = 2 Lot = 29,2 g.
Das kleinste Goldgewicht heißt As = 1/15 Gran.
Als Einheit des Münzgewichtes galten vielfach das holländische Troys-Pfund = 10.280 As,
die Kölner Mark = 4867 holländische As und die Wiener Mark = 6/5 Kölnische
Mark = 5841 holländische As.
Bei den Münzen, besonders den wertvolleren Goldmünzen, musste darauf gesehen
werden, dass sie das richtige Rauhgewicht (Schrott) und das richtige Feingewicht (Korn)
hatten. Um letzteres zu prüfen, hatte man den Probierstein, einen schwarzen
Kieselschiefer (Lydit); ersteres wurde durch im voraus genau abgewogene Münzgewichte
auf der Waage bestimmt. Wir wollen nur einige Münzen erwähnen, deren Gewichte
in der Sammlung öfter wiederkehren.
Der Dukaten wurde 1140 unter Roger II von Apulien eingeführt. Der Name kommt vom
letzten Worte der Inschrift: Sit tibi Christe datus, quem tu regis, iste Ducatus. In
Florenz wurden 1252 Goldmünzen geprägt, die den Namen florenus, in Deutschland
Goldgulden, erhielten. Unter Karl V. (1519-1556) entstand die Doppelkrone (Dublone), unter
Ludwig XIII. (1616-1643) der Louisd‘or. In Österreich und Belgien waren
außerdem Souveraind‘or im Werte von 14 Gulden im Gebrauch.
Um spätere Wiederholungen zu vermeiden, wollen wir die Schwere der einzelnen Waagen
bei gegebenen Münzgewichte in Grammen angeben.
|
1 Dukaten 3,2 - 3,5 g 2 Dukaten 6,7 – 7,0 g 8 Dukaten 27,9 g ½ Dublone 3,4 – 3,5 g 1 Dublone 6,7 – 6,9 g 2 Dublonen 13,4 g 4 Dublonen 28,5 g 1 Krone 6,6 – 7,0 g |
1 Goldgulden 3,2 – 3,6 g 1 Louisd‘or 8,1 g ½ Loys 3,3 g 1 Loys 6,6 g 2 Loys 13,3 g 4 Loys 26,8 g ½ Souvrain 5,6 g 1 Souverain 11,1 – 11,5 g |
Auf diesen Gewichtsstücken finden sich, wie es scheint ohne Regel, öfter wiederkehrende Figuren eingeprägt; diese sind, soweit sie sich erkennen lassen, folgende:
Zwei einander zugewandte Köpfe mit Kronen; ein König mit dem Reichsapfel in einer
Hand, mit einem Szepter oder häufiger einer Hellebarde in der anderen, manchmal mit
angehängtem Schwerte, auf einigen dabei die Buchstaben HD oder AD; ein stehendes oder
liegendes Kreuz; der Reichsapfel in schildförmiger Umrahmung; ein Wappenschild mit einer
Krone und drei Lilien; vier Kronen oder vier Lilien, symmetrisch verteilt; und zwei
L-förmige Zeichen ineinander verschlungen.
Von der Waage machte man im Stifte, von den alltäglichen Käufen und Verkäufen
abgesehen, in der Apotheke und in den Ämtern (Abtei, Hofrichterei, Rentamt [früher
Camerei], Küchenamt u. s. w.) Gebrauch. Waagen für den physikalischen Unterricht
finden wir im mathematisch-physikalischen Museum, das unter dem Namen „Mathematische
Stube“ im Jahre 1747 für Unterrichtszwecke eingerichtet wurde.
P. Laurenz Doberschitz zählt 1764 in seiner
Beschreibung der ersten Einrichtung des 1760 vollendeten
„Mathematischen Turmes“, wohin die bisher gebrauchten Instrumente übertragen
wurden, folgende Waagen auf: Eine adcurate Goldwaage in einem schwarzen Glaskasten
(No. 2 oder 3 dieses Verzeichnisses), eine Probierwaage
(No. 1), eine hydrostatische Waage, ähnlich wie die
heutigen, und eine Anzahl Aräometer. Die meisten der übrigen Waagen sind erst um 1900
der historischen Sammlung des mathematischen Turmes einverleibt worden.
Über das Alter der einzelnen Waagen und den Verfertiger läßt sich wenig
ermitteln. Kein Stück dürfte über das Jahr 1600 zurückgehen. Die
älteste datierte Waage (No. 10) ist von 1638, gemacht von M. Wilhelm von Essen in
Köln. Auf den Ankauf derselben wird sich die Rechnung No. 50 der Camerei vom Jahre
1639 beziehen: „Für ain Neue Goltwag in die Camerei zalt ein fl. 4ß.“
Eine andere Goldwaage wird 1650 für die Schaffnerei bei „Salome Gihlerin,
Witib und Glockhengießerin in Lintz“ um 1 fl. 30 Kr. angekauft.
[Einfügung: Es findet sich aus dem Jahre 1658 folgende Rechnung (Camerei 1658, No. 470)
Thomae Pfefferhofer, Hammerschmidt zu Steyr vor 90 ¾ Pfund Eisengewichter zur
Geltwag, iedes per 1 ß macht 11 fl. 2 ß 24 d.] Ferner finden sich noch die
Jahreszahlen 1736 IL, 1740 und 1771 (Brander). Ohne Jahreszahl sind genannt
Friedrich Tauber1),
Martin de Backer in Amsterdam und Schindler, Mechanicus et Mathematicus.
Die Signaturen AD, JL, JS, JCW (Joh. Christ. Wagner, Augsburg ?) JPH, JLR, RA, WVZ und das besonders
auf den Münzgewichten häufig wiederkehrende HD vermag ich derzeit nicht zu deuten.
P. Eugenius Dobler, Benedictiner von Irsee, der durch Vermittlung P. Anselm Desings am 18. Dec. 1746 nach Kremsmünster übersiedelte, um hier an der neugegründeten Akademie „Matheseos encyclopaediam“ zu lehren, bereicherte sein physikalisches Cabinet, „die Mathematische Stube“ genannt, mit drei empfindlichen und zugleich sauber gearbeiteten Probierwaagen, die heute noch vollkommen erhalten sind (No. 1, 2, 3).
1
Vielleicht in verwandtschaftlicher Beziehung zu Leonard Tauber in Augsburg, der wegen seiner
Erfahrung im Münzwesen als Abgeordneter auf den Augsburger Münz-Probationstag geschickt wurde. Gest. 1774
1. Probierwaage. [Inv. Nr.: 11091019] Die Außenteile der Waage sind ein schön eingelegter,
polierter Holzkasten (31,5 x 20 x 12 cm) mit einer Lade und ein darauf gesetzer Glaskasten
mit vergoldetem Rahmen (23 x 10 x 10 cm).
Im Innern des Holzkastens sind der Waagebalken, die Welle mit Schneiden, die Waagschalen und
die Arretiervorrichtung, im Glaskasten das Zünglein, ein Lot und die Gegenzunge.
Der Waagebalken von 26 cm Länge ist von steifem Stahldraht verfertigt; die Enden
sind vertikal aufgebogen und tragen frei balanzierend je einen abgestumpften Hohlkegel,
deren obere Flächen schalenförmig vertieft sind; auf diesen liegen frei die
kleinen Waagschalen von 1,5 cm Durchmesser. Die 8 cm lange Welle sitzt mit zwei Schneiden
auf Messingträgern; am vordern Ende derselben sind die Waagebalken eingefügt,
auf der hinteren Seite erhebt sich das 18 cm lange, in den Glaskasten hineinragende
Zünglein. Hinter dem selben hängt an einem Messingsäulchen von 17 cm
Länge ein Doppellot aus Stahllamellen, in dessen Mitte das Zünglein bei
Gleichgewicht und horizontaler Lage der Waage stehen muß. Überdies wird die
Gleichgewichtsstellung durch das Gegenzünglein scharf markiert. Durch ein von
außen zugängliches Hebelwerk läßt sich der Waagebalken arretieren;
bei weiterer Bewegung des Hebels hebt ein Ring die auf den Kegeln frei ruhenden Schalen ab.
Diese sind oben mit zwei Hohlgläsern überdeckt, die sich wie ein Krugdeckel bewegen
lassen. Es geschieht daher die ganze Wägung in einem ziemlich gut abgeschlossenen Raume.
Eigene Gewichtsstücke sind nicht vorhanden.
Im Verzeichnis von P. Laurenz Doberschitz (Mechanica No. 20) als Goldwaage, „subtil und
artig“, 1764 aufgeführt.
P. Eugenius Dobler, Benedictiner von Irsee in Baiern, der 1746 – 1762 in unserem
Stifte tätig war, zählt unter den Apparaten, die er auf seine Kosten hierher
brachte und wofür er 1762 vom Abte Bertold Vogl eine Entschädigung verlangte,
3 Probierwaagen auf, ohne Zweifel die, welche zwei Jahre später bei P. Laurenz Doberschitz
unter No. 19, 20, 21 (in diesem Verzeichnis No. 1, 2, 3) vorkommen.
2. 3. Hängewaage in Glaskasten. [Inv. Nr.: 11091020 und 11091022) Zwei nahezu gleiche
Stücke. Über einem
Holzkasten (36 x 27 x 8 cm) erhebt sich ein Glaskasten (49 x 36 x 13 cm) mit einem Türchen.
Das Holzwerk ist fein schwarzbraun poliert und sauber gearbeitetet; der Untersatz hat zwei
Laden. Im Glaskasten ist eine zweiarmige Waage aufgehängt. Der Vorderteil der Schere
ist mit einem kunstvoll gravierten und vergoldeten Adler verziert, der bei einem Stück
einköpfig, beim andern zweiköpfig ist. Darüber ist ein Wappenschild; auf
einem ist eingraviert: Schindler M et M fecit, das andere ist leergelassen. Die ganze
Waage läßt sich durch eine an einem schweren Messingklotz befestigte Schnur
heben und senken, um nach Belieben die Schalen frei zu bekommen oder sie auf das
achteckige, mit einer Messingplatte bedeckten Holzbrettchen zu senken.
In P. Laurenz Doberschitz Verzeichnis von 1764: Mechanica No. 19 und 21.
4. Größere Hängewaage. [Inv. Nr.: 11091017] Braunes Holzkästchen (31,5 x 14 x 4,5 cm) mit Lade. Die Schere schön graviert und vergoldet. Die Waage hängt frei an einem Holzsäulchen; sie hebt sich, wenn man die Lade herauszieht vermittels einer Schnur; schiebt man die Lade hinein, so ruhen die Schalen auf dem Holzkasten. Es ist ein eigenes Gegenzünglein angebracht. In der Lade sind 17 Münzgewichte und einige Zulagstücke; zwei Stück ½ Souveraind‘or sind aus Kupfer, die anderen aus Messing (meist zwei gleiche): 4 Loys, 2 Loys, 1 Louisd‘or, 2 Dukaten, 1 Loys, 1 Dublone.
5. Hängewaage. [Inv. Nr.: 11091014] Auf einem braunen Holzkästchen mit Lade (18,7 x 11,7 x 3 cm) erhebt sich eine gedrechselte Säule, unten aus Holz, oben aus Messing, die am obern Ende einen Hebel trägt. Am vordern Teile desselben hängt die Waage, vom hintern Ende geht eine Schnur aus, die mit einem auf dem Holzkästchen liegenen rundlichen Messingklotz in Verbindung ist. Diesen kann man so vorwärts oder rückwärts schieben, dass sich die Waage hebt oder senkt, wodurch die Waagschalen frei werden oder aufliegen. Auf einer Schale ist JGH eingepresst. Beiliegende Münzgewichte: 4 Dublonen, 2 Dublonen, 1 Dublone, 1 Goldgulden, 2 Dukaten und 1 Dukaten. Im Schubfach Zulagstücke.
6. Äußerlich wie No. 5. [Inv. Nr.: 12010901] etwas stärker und genauer ausgeführt. Brauner Holzkasten (22,5 x 13,5 x 5 cm) Eichstempel 786 auf der Waage, auf Münzgewichte 771. 19 Münzgewichte ohne Namen, aber vom Gewichte der Dukaten, eingeprägt zwei Kaiserköpfe, der Reichsapfel, stehendes Kreuz, König mit Reichsapfel und Hellebarde HD.
7. Wie No. 5. [Inv. Nr.: 12010902] Holzkasten braun (21 x 12,5 x 4 cm). Auf der Schale JCW eingepreßt. In der Lade ein alter Prüfstein und 8 Münzgewichte; bezeichnet 1 Souverain und ½ Souverain, die übrigen vom Gewichte der einfachen und doppelten Dukaten. 1905 vom Rentamte der Sammlung übergeben.
8. Wie No. 5. [Inv. Nr.: 12010903] Der braune Holzkasten (20 x 12 x 4 cm). In die Schale eingepreßt JGH. Münzgewichte nicht beiliegend.
9. Wie No. 5. [Inv. Nr.: 11091015] Der braune Holzkasten (19,5 x 11,5 x … cm). Auf der dreieckigen Schale eingepreßt JGH.
10. Handwaage. [Inv. Nr.: 17123001] (Waage und Münzgewichte fehlen). Holzkästchen mit eingepressten
Verzierungen, gekrönter Schild mit AD (29 x 12 x 3 cm).
Aufschrift: „Wag und Gewicht macht M. Wilhelm von Essen wonende uff Plückhoff
In Cöllen Anno 1638.“ War sehr reichhaltig an Münzgewicht, wie noch aus
den teilweise unlesbaren Aufschriften zu ersehen ist: 4, 2, 1 Pistoletten; 1, ½
Millerees; Dubelducat, ½ Ducat, Ungers-, Portugalducat; Rosenobel, Engelo, Albertus,
Schifnov, Real, Taeoben, Hollendse Ritter, Goldgulden, Morisko, Keisers, Kronen, Engl.
Kronen. Italienische Kronen.
10. Okt. 1894 aus der Kanzlei der Kirchenverwaltung erhalten
11. Handwaage. [Inv. Nr.: 17123004] (Waage fehlt) Holzkästchen (10,6 x 5,5 x 1,8 cm) schwarz poliert, außen adlerartige Verzierung eingeschnitzt. Innen ein Bildchen eingeklebt mit zwei bemalten Figuren, dem niederländischen Wappen und der Inschrift: Dese Gewichten maeckt Martinus de Backer in de Onde Br‘ugh Steegh in de go‘ude Munt Balans tot Amsterdam. Boden mit roter Seide ausgekleidet. Hebstift. 10 Gewichtsstücke mit der Bezifferung 32, 16, 8, 4, 3, 1, ½, ¼, 1/8, 1/16; das erste und schwerste wiegt 6,6 g. Welchem Gewichtssystem sie angehören, ist nicht bekannt.
12. Handwaage. [Inv. Nr.: 12010718] Holzkästchen (12,5 x 5,5 x 2,5 cm), braun poliert, Deckel mit
Messingscharnieren, Boden mit Buntpapier ausgeklebt; Aufschrift außen 1736 IL.
Waage gewöhnlicher Konstruktion, an der Schere zu halten, Schalen aus weißem
Messing, eine rund eine eckig. Münzgewichte mit Aufschrift auf den Stücken
selbst: 4 Loys, 2 Loys, 1 Loys, ½ Loys; 8, 4, 2, 1, ½ Ducat. Ein
überzähliges Dukatengewicht mit den Buchstaben W V Z und dem Eichstempel
738. Im Schubfach 4 Zulagstücke.
1905 vom Rentamte erhalten.
13. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091003] Holzkästchen (11,2 x 5,8 x 1,9 cm), außen mit
eingepreßten Sternen. Einfache Waage. Auf der dreieckigen Schale die
Buchstaben JW. 5 Münzgewichte: 2 Stück Doplon, ½ Doplon, 1 Ducat,
1 Goltguln. Aufschrift Recht abgezogen.
1905 vom Rentamte erhalten.
14. Handwaage. [Inv. Nr.: 12010721] Holzkästchen (13 x 5,9 x 2 cm) mit Decken an Drahtscharnieren,
Aufschrift: JL Abgezogen. Einfache Waage; auf den runden Schalen eine dreiteilige
Blume. Mit Buntpapier ausgekleidet. 7 Münzgewichte: 2, 1 Ducaten; 1, ½
Doplon; 1 Soj (?), ½ Doplon, 1 Goltgulden; außerdem 3 Zulagstücke.
1905 vom Rentamt erhalten.
15. Handwaage. [Inv. Nr.: 12010720] Holzkästchen (16,7 x 6 x 2 cm), Drahtscharniere, Waage feiner ausgeführt. Auf dem Deckel: Friedrich Tauber, darüber, sowie auf einer Schale zwei Tauben. 7 Münzgewichte: 4, 2, 1, ½ Doublon; 1 Louidor, 1 Goldgulden, 2, 1, 1 Ducat; Im Schubfach 4 Zulaggewichtchen.
16. Handwaage. [Inv. Nr.: 12010719] Holzkästchen (13,5 x 6 x 2 cm), Deckel mit Drahtscharnieren. Auf den runden Schalen zwei gekreuzte Pfeile und JS. Seidenquaste zum bequemen Halten der Schere. Hebstift. 7 Münzgewichte: 1, ½ Doublon; 1 Cron, 1 Goltgulden; 2, 1 Ducat (3,2 g), 1 Ducat (4,0 g). Im Schubfach 17 kleine bezeichnete Gewichte. Aufschrift: Recht abgezogen. Auf der Außenseite ist mit Tinte die Jahreszahl 1740 geschrieben.
17. Handwaage. [Inv. Nr.: 17123005] Holzkästchen (10,5 x 6, 3 x 2 cm), Drahtscharniere. Wäglein
einfachster Konstruktion. Auf der dreieckigen Schale HW, auf dem Deckel „Recht
abgezogen“. Außen Sterne eingepreßt. 6 Münzgewichte: 2,
1 Ducat, 2 Stück in einem Fach mit unlesbarer Aufschrift, 1 Kron, 1 Goltgulden.
Im Schubfach ein überzähliges Stück (3,2 g) und 4 Zulaggewichte.
16. 1. 1899 aus der Abtei erhalten.
18. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091008] Holzkästchen geschweift, längste Dimensionen 13 x 6 x 2. Drahtscharniere. Auf dem Deckel und auf einer Schale der König mit Reichsapfel und Hellebarde (HD) eingepreßt. Die Waagschalen sind ungleich schwer. Die Einrichtung der Waage ist auf dem eingeklebten Zettel angegeben: „ Ein Wäglein, ohne Gewicht einen Ducaten, mit dem Gewicht eine Duplone zu wägen. Auf dem Bogen sind die Esse abgeteilt“. Auf der Seite der leichteren Schale ist nämlich ein Bogen mit 6 Kerben, die angeben, um wieviel As die Münze zu gering ist. Das erwähnte Gewicht ist noch vorhanden.
19. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091005] Ähnlich wie No. 18; schöner ausgeführt (12,5 x 6,2 x 2,0 cm). Die Gebrauchsanweisung lautet: „Ein Wäglein, ohne Gewicht einen Ducaten zu wegen. Auf dem Bogen sind die Esse geteilt von 1 biß 6. 64 Esse wegen einen Ducaten.“ 1905 aus dem Rentamte erhalten.
20. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091006] Ähnlich wie No. 18. sorgfältig ausgeführt (12,5 x 6 x 1,9 cm). Inschrift: „JL. Ein Wäglein, ohne Gewicht einen Ducaten zu wiegen. Auf dem Bogen für die Esse abgeteilt a 1 bis 6. 64 Esse wiegen 1 Ducaten.“ Drei Gewichtsstücke (3,3 g, 3,5 g, 6, 8 g) ohne Bezeichnung beiliegend.
21. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091007] Ähnlich wie No. 18; solid ausgeführt. (13,2 x 6 x 2 cm). Auf dem Deckel und auf einer Schale der König mit Reichsapfel und Hellebarde und den Buchstaben RA, HD; auf der andern Schale zwei gekreuzte Pfeile und die Buchstaben IS. Der Bogen ist auf der Außen- und Innenseite mit je 6 Kerben versehen. Die Inschrift: „Ein Wäglein ohne Gewicht, einen Ducaten zu wägen, auf den Bogen sind die Esse abgetheilet 1 biß 6.“ Die Schere fehlt. 24. 2. 1905 aus dem Küchenamte erhalten.
22. Handwaage. [Inv. Nr.: 11091004] In einem dreieckigen schwarzen Lederetui, außen Goldpressungen
mit einem kleinen Doppeladler, innen rothes rauhes Leder (18 cm). Fein und solid
ausgeführte Waage; zwei runde Schalen, auf einer 786, auf der andern eine
Blume eingepreßt. Auch auf der Schere und 4 Gewichtsstücken der Eichstempel
786. Münzgewichte: 2, 1 Ducaten; 1, ½ Souverain.
1905 vom Rentamte erhalten.
23. Handwaage. [Inv. Nr.: 11090515] braunes, viereckiges Lederetui (13 x 8,5 x 2 cm), außen einfache
Goldpressung mit Doppeladler, innen weiches, gelbliches Leder. Waage sorgfältig
und solid gearbeitet. Auf der Schere, einer Schale und einem Münzgewichte Eichstempel
791, auf andern 771 und 786. 4 Münzgewichte: 2, 2, 1 Ducat, ½ Souverain.
11. 3. 1898 von P. Rupert Viehaus erhalten.
24. Apothekergewichte. [Inv. Nr.: 17123003] 1 Pfund: 12 köllner Unzen á 8 Drachmen
á 3 Skrupel á 20 Gran. Meist doppelt vorhanden: 1 Unze; 4, 2, 1,
½ Drachmen; 2, 1½, 1, ½ Skrupel; 1 – 10 Gran.
Teilweise geeicht.
Gespendet von P. Benno Waller (P. Bonifaz Schwarzenbrunner, XII, 1816 No. 6)
25. Münzgewichte. [Inv. Nr.: 17123002] In einer halbkugeligen Holzdose (5,5 cm Durchmesser) 4 Stück: 1, ½ Souverain; 2, 1 Ducat. Eichstempel Doppeladler und 774. Preis 45 Kr angeschrieben.
26. Behältnis eine Pappschachtel [Inv. Nr.: 17123006] (18 x 12,5 x 3,1 cm), rosa mit reichen Pressungen.
Innen noch eine Tasse. Diente offenbar zur vorübergehenden Aufbewahrung von Münzen
oder auch Spielmarken.
12. 2. 1897 aus der Abtei.
27. Hydrostatische Waage [Inv. Nr.: 16070202] von Georg Friedrich Brander, Augsburg 1771. [Inv. Nr.: 16090303]
Schwarzes Lederetui in Gestalt eines Viertelkreises mit Pressungen; innen rotes
Leder und blaue Seide.
Aufschrift: G. F. Brander fecit Aug. Vind. Auf ein Grundbrett läßt sich ein
40 cm hohes, in kurze Teile zerlegbares Messingsäulchen aufschrauben. Am Ende
desselben hängt die Schere einer Waage mit Glasstäbchen als Achsenlagern.
Die Waagebalken sind durch ein Rädchen ersetzt, in dessen rinnenförmig
ausgeschnittenen Umfang eine Schnur liegt; an dieser hängt eine Glaskugel (fehlend),
die in ein mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefülltes Glas taucht.
Die Achse des Rades ist aus rundem Stahl; auf ihr hängt eine Gabel mit einem
Roßhaarsenkel, der als Index dient. Vom Rade aus geht ein 6 cm langer Messingarm,
an dem ein Skalenbogen befestigt ist. Er hat drei Teilungen, zwei auf der Vorderseite
zur direkten Ablesung, eine auf der Hinterseite, die in einem Planspiegelchen sichtbar ist.
Die erste Skala gibt den Salzgehalt einer jeden Sole an, für welchen Zweck die Waage
ursprünglich angefertigt ist (0 – 14);
die zweite zeigt das Gewicht eines Kubikschuhes der untersuchten Flüssigkeit an
(churbairisches Maß), wobei das Gewicht eines Kubikschuhes Regenwasser zu 44,5
Pfund angenommen ist (41,5 – 53,5); Die Skala der Rückseite gibt das
Verhältnis des Gewichtes einer Flüssigkeit zu dem des reinen
Wassers (gleich 1000 gesetzt) in Tausendteilen (933 – 1200). Taucht also
die an der Rolle hängende Glaskugel in reines Wasser, so steht die Skala
pro pondere salis auf 0, die Scala hydrostatica auf 44,5, die Scala pro partibus
milesimis auf 1000. Nimmt man eine schwerere Flüssigkeit, z. B. Eine Sole,
so zeigt der Haarsenkel z. B. bei der ersten Skala auf 2 5/8 (soviel Pfund Salz
in einem Kubikschuh Sole), bei der zweiten auf 46 1/8 (Gewicht eines Kubikschuhes
dieser Flüssigkeit), bei der dritten auf 1036 ½ (Verhältnis des
Gewichtes der Salzsole zu dem des reinen Wassers 1,0365). Analog erhält man
das wirkliche und spezifische Gewicht einer leichteren Flüssigkeit.
Die Waage ist sauber aus Messing gearbeitet und gut erhalten; nur die Glaskugel fehlt,
die im Innern mit einem sehr kleinem Thermometer versehen war.
(P. Bonifaz Schwarzenbrunner, 1811, No 28) Beschrieben und abgebildet in: Beschreibung
einer neuen hydrostatischen Waage von G. Fr. Brander Augsburg 1771. Über die Waage
finden sich Notizen in den Briefen Branders an P. Placidus Fixlmillner 1771,
9. März
(No. 8), 20. Mai (No. 11),
6. Dez. (No. 12),
31. Dez. (No. 13). In letzterem kündigte
er die Absendung mehrerer Instrumente an, unter denen sich auch obige Waage befand nebst der
gedruckten Beschreibung. Preis 45 fl. Die wichtigsten Daten über Branders Leben sind
enthalten in: Kunst-, Gewerb- u. Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg von Paul v.
Stetten, Augsburg 1779.
28. Heuwaage. [Inv. Nr.: 13012110] Auf einem Brettchen (16 x 11 x 3 cm) stehen zwei Balken von 35 cm Höhe; sie tragen eine Schnellwaage (Waagebalken 38 cm lang). Am kürzeren Ende kann der Lastwagen aufgehängt werden. Es sind ja nach der Größe der Last drei vom Drehungspunkte ungleich weit entfernte Aufhängehaken. Die Anfertigung von Schnellwaagen für große Lasten wird Leupold (1674-1727, Mechanicus in Leipzig) zugeschrieben. Eine von ihm 1718 in Leipzig angelegte Heuwaage ist beschrieben Leup. Theatr. Stat. Univ. P. I. Lips. 1726, fol c. 6
P. F. S. [P. Franz Schwab] 1906: Die Wagen der historischen Sammlung des mathem. Turmes, MS, Direktions-Archiv
BRANDER, Georg Friedrich 1771: Beschreibung einer neuen hydrostatischen Waage, nebst zweyen hiezu gehörigen
Abhandlungen. Mit Kupfern, Augsburg
DOBERSCHITZ, P. Laurenz 1764: Specula Cremifanensis, MS CCn 1048 (Herausgegeben von P. Amand Kraml als Heft Nr. 40
der Berichte des Anselm Desing Vereins, Februar 1999)
LEUPOLD, Jacob 1726: Theatrum Staticum, das ist: Schau-Platz der Gewicht-Kunst und Waagen, Pars I, Leizpig