
Schülerzeichnung Inv. Nr. 293
Foto: P. Amand Kraml
aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Oktober 2014


Schülerzeichnung Inv. Nr. 300
Blattgröße: 24,3 x 36,5 cm
Foto: P. Amand Kraml

Schülerzeichnung Inv. Nr. 307
Blattgröße: 24,3 x 36,5 cm
Foto: P. Amand Kraml
Einige der 310 botanischen Schülerzeichnungen, die unter dem Zeichenlehrer des Internats Johann Georg Riezlmayr angefertigt wurden, tragen auf der Rückseite die Bemerkung Nach der Natur gezeichnet. So bieten diese Zeichnungen unter anderem einen recht interessanten Einblick in die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Kremsmünster kultivierten Nutzpflanzen. Leider fehlen bei den Bildern der Kernobstsorten jegliche Angaben auf der Rückseite. Inzwischen stellte sich heraus, dass einige der Zeichnungen Kopien der Tafeln aus dem in Weimar erschienenen Allgemeines Teutsches Garten-Margazin des Jahres 1809 Man hat sich also im Zeichenunterricht von Riezlmayr offensichtlich auch mit dem Abzeichnen beschäftigt. Der rote Klapper-Apfel und die Birne mit dem Weidenblatt gehören dazu und wurden hier zur Präsentation ausgewählt. Die weiteren Aquarelle, die Kernobstsorten darstellen, sind aufgelistet. Leider kennen wir in diesem Fall die Zeichner nicht. Es fällt aber auf, dass die Aquarelle, für die im Garten-Magazin keine Vorbilder zu finden sind, die Früchte von unten zeigen (vgl. Großer Rosen-apfel). Diese eher ungewöhnliche Stellung gibt der Vermutung Nahrung, dass diese Zeichnungen echtes Obst als Vorlage hatten.
Eine interessante Bemerkung zum Obstbau und vor allem zur Namensgebung der
Obstsorten finden wir bei Johann Siegmund Valentin Popowitsch. Dieser
war in den Jahren 1744-1746 Lehrer an der Ritterakademie in Kremsmünster
und hat sich hier auch mit Botanik, seinem Lieblingsfach, beschäftigt.
In seinem weitläufigen Werk Untersuchungen vom Meere ... setzt er sich in dem
Teil Nachlese von Zugaben recht kritisch, ja polemisch, mit der Botanik und
Nomenklatur von Carl von Linnè auseinander. Im 2. Abschnitt mit dem Titel Daß die
Linnäische Lehre der Botanik offenbar schade,
verführerisch sey, und manchmal sich selbst widerlege berichtet Popowitsch vom
Obstbau und über die Namensgebung in demselben in unserem Kremstal:
Im Kremsthale in Oberösterreich heißt der Porstorfer, Hasenapfel: welches
ich hier aus einer zweyfachen Absicht erinnere. Erstlich, um darzuthun, daß
gewisse Früchte noch heutiges Tages, nicht nur von der Gestalt, Farbe, ihrem
Geschmacke, von der Jahrszeit, in welcher sie reifen, von den Orten, an
denen sie wachsen, sondern auch von denjenigen Liebhabern, die eine Art etwan
hochhalten, oder von denen sie aus einer Gegend in die andere überbracht
wird, die Benennungen erlangen. Solches war schon zur Zeit der Römer
auch so gebräuchlich, wie es die Plinischen Namen der Äpfel, Birnen,
und der übrigen Obstgattungen bezeugen. Der Ländlerische Name Hasenapfel
hat diesen Ursprung, weil ein Pfleger zu Pernstein (ist eine Kremsmünsterische
Herrschaft in erwehntem Thale) den Porstorfer zuerst in dieselbe Revier
gebracht. Dieser Pfleger hat Haas geheißen. Daraus aber fliesset die
zweyte Anmerkung, daß ohne Zweifel noch manche andere Namen der Früchte
eben so leichte Erklärung haben werden, allein die izt unerforschlich sind,
weil uns der Mangel der Gartengeschichte die Schlüssel zu deren Eröfnung
entzogen hat. Das Land ob der Ens ist eine rechte Pflanzschule für die Obstbäume,
welches meines Erachtens daher kommet, weil hier die Weingärten aufhören,
und dieses das erste Bierland ist, wenn man aus Unterösterreich nach der
Donau aufwärts ziehet. Die Inwohner wollden doch den Weingeschmack
nicht auf einmal mit dem Biere vertauschen. Sie behelfen sich, zur Abwechselung,
stark mit dem Äpfel- und Birnmoste. Sie pflanzen desßwegen eine
unbeschreibliche Menge Obstbäume, denen der feuchte Boden, und die kühle
Luft anständig ist. Es hat schon Joh. Bauhin in Acht genommen, daß es
in den warmen Ländern wenig Äpfelbäume gebe. Da nun die Bauern aus den
Gärten viele unbekannte Arten theils gütlich erhalten, theils stehlen, und
den auf die letzte Weise überkommenen (wie es bei den Findlkindern geschiehet)
nicht wissen die rechten Namen zu geben, so heißen sie ihre Äpfel sehr
lächerlich, Tennäpfel, Stalläpfel, Zaunäpfel, Neunmezenäpfel etc.
weil sie den Baum bei ihrer Tenne, beim Stalle, beim Zaune, stehen haben;
oder weil der Baum einmal 9 Mezen Früchte getragen hat. Wenn sie die
Zweige andern mittheilen, so vervielfältigen sie dergestalt diese seltsamen Namen,
daß einige derselben gemein werden. Nun gehen die Wortforscher hin,
und zerbrechen sich die Köpfe, um die Bedeutung dieser Benennungen herauszubringen,
wenn sie von dem läppischen Ursprunge derselben nicht unterrichtet sind.
(Popowitsch, 358-359)
Auch führt Popowitsch an, dass der Porstorfer in Österreich unter dem Namen Maschanzker bekannt sei. Als einer der bedeutendsten Wortforscher seiner Zeit versucht er auch eine Ethymologie für diesen Namen. Er meint nämlich: ...er ist, meines Erachtens, der Römer malum Scantianum, dessen Plinius, XV, 14 gedenket. (Popowitsch, 358)
Genauso gibt es auch heute noch keine wirklich einheitliche Terminologie für die Kernobstsorten. Bei unserem Klapper-Apfel handelt es sich um die sehr alte Sorte des Prinzenapfels. Er ist in Bayern als Glockenapfel, weiter nördlich auch als Rotgestreifter Schlotterapfel oder auch als Ananas-Apfel bekannt. Dieser Name wird auf den Geruch der Schale zurückgeführt. Jedenfalls handelt es sich um eine recht robuste Sorte, die auch für die rauesten Lagen geeignet ist. In der Liste unseres Hofgärtners Josef Runkel ist er ebenfalls als Prinzenapfel angeführt (Nr. 177, RUNKEL, 9).
Die Weidenblatt-Birne Pyrus salicifolia aus dem Kaukasus stammend, ist sicher seit 1780 in Kultur.
Man kann sie allerdings heute nur mehr gelegentlich als Ziergehölz oder eventuell als Veredelungs-Unterlage antreffen.
Die Früchte sind mit 1,5-2 cm ausgesprochen klein und stark astringierend, so dass sie heute als Obst wohl nicht mehr
in Frage kommen.
| 288 |

|
Anatomie des Apfels | - | Garten-Mag. 5 |
| 289 |

|
Die Englische Bergamotte | Runkel Nr. 11 | Garten-Mag. 20 |
| 290 |

|
Die Durst-Lösche | - | Garten-Mag. 45 |
| 291 |

|
Kassel Reinette (Ist größer gemacht) |
Runkel Nr. 198 | - |
| 292 |

|
Gestreifter Winter Calville | - | Garten-Mag. 19 |
| 293 |

|
Der rothe Klapper Apfel | Runkel Nr. 177 | Garten-Mag. 3 |
| 294 |

|
Der gestreifte Winter Kurzstiel ? | Runkel Nr. 116? | - |
| 295 |

|
Perlreinette | Runkel Nr. 197 | - |
| 296 |
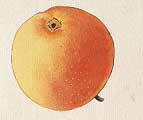
|
Reinette von Holland | - | - |
| 297 |

|
Gelber Gülderling | Runkel Nr. 91 | - |
| 298 |

|
Die gedüpfte Reinette | - | - |
| 299 |

|
Spitzer Goldzungapfel | Runkel Nr. 84 | - |
| 300 |

|
Grosser Rosen-apfel | - | - |
| 301 |

|
Frucht des Chinesischen Apfelbaums | - | Garten-Mag. 24 |
| 302 |

|
Violette rayee | - | - |
| 307 |

|
Birn mit dem Weiden-Blatte | - | Garten-Mag. 12 |
| 308 |

|
Der graue Junker Hans Messire Jean-gris |
Runkel Nr. 140 | Garten-Mag. 6 |
Allgemeines Teutsches Garten-Margazin oder gemeinnützige Beiträge für alle Theile des praktischen Gartenwesens, Sechster Jahrgang, 1809, Weimar
ANONYMUS (J. S. V. P.) [Johann Siegmund Valentin Popowitsch], Untersuchungen vom Meere, die auf Veranlassung einer Schrift de Columnis Herculis, welche der hochberühmte Professor in Altorf, Herr Christ. Gottl. Schwarz, herausgegeben, nebest andern zu derselben gehörigen Anmerkungen, von einem Liebhaber der Naturlehre und der Philologie, vorgetragen werden, Frankfurt und Leipzig 1750
BERNKOPF, Siegfried, KEPPEL, Herbert & NOVAK, Rudolf 1991: Neue alte Obstsorten, Äpfel und Birnen, 2. Aufl. Wien
CZERNI, Margret 1993: Stifters Zeichenlehrer Georg Riezlmayr, in: Kulturzeitschrift blickpunkte 43. Jg. Heft 1, Linz
FÜRST, Johann Ev. o. J. [1823]: Der verständige Bauer Simon Strüf, eine Familien-Geschichte. Allens Ständen zum Nuzen und Interesse,
besonders aber jedem Bauer und Landwirthe ein Lehr- und Exempel-Buch, 3. Theil, Passau
PFEIFFER, P. Anselm 1887-90: Anmerkungen für die naturhistorischen Museen der Sternwarte in Kremsmünster. Beginnt mit 24. Juli 1887 - 1890, MS [in AP3] im Kustodiatsarchiv der Sternwarte, Kremsmünster
RUNKEL, Josef 1867: Verzeichniss der Obst-Sortimente, welche in dem Hofgarten und den Nebengärten des Benediktiner-Stiftes zu Kremsmünster kultivirt werden
SCHMIDT, Peter A. 2006: Bäume und Sträucher Kaukasiens, in: Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Nr. 01, Stuttgart, 36
VERFASSER des Simon Strüf o. J. [1823]: Kurze Nachricht über Frauendorf und die dort angelegten Gärten und Baumschulen, in:
FÜRST. Joh., Der verständige Bauer, Passau, 449-518