
Magnetstab: Eisen, 64 x 4 x 1,2 cm, 2,3 kg
Kasten: Holz, Glas, 100 x 52 x 24 cm
Inv. Nr.: 19022502
Foto: P. Amand Kraml (200607110051)
aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Mai 2006

|
Gauss'sches Magnetometer mit Magnetstab und Spiegel Magnetstab: Eisen, 64 x 4 x 1,2 cm, 2,3 kg Kasten: Holz, Glas, 100 x 52 x 24 cm Inv. Nr.: 19022502 Foto: P. Amand Kraml (200607110051) |

Foto: P. Amand Kraml (200103220051)
Die Verbindung mit Johann v. Lamont (1805-1879) in Bogenhausen und Carl Kreil (1798-1862) veranlassten
P. Marian Koller
sich intensiver mit diesem neuen Bereich der Geophysik zu beschäftigen. In Poggendorffs Annalen der Physik
und Chemie des Jahres 1833 wurde eine Beschreibung des von Gauss in Göttingen in seinem magnetischen Observatorium
verwendeten Magnetometers abgedruckt (POGGENDORFF, 247-251). Seit 1835 bestand der in Göttingen gegründete
magnetische Verein.
1839 wurde dann das Gauss'sche Magnetometer für Kremsmünster aus der Werkstätte von Moritz Meyerstein (1808-1882) in
Göttingen angeschafft. Es wurde im Astronomischen Kabinett, das damals als solches keine Verwendung mehr
fand, aufgestellt. Um den
Einfluss der alten Instrumente mit ihren großen Eisenmassen auszuschalten, entfernte man die zwei großen
Mauerquadranten, den Zenit-Sektor und die Fernrohre zur Beobachtung der Polarsterne aus dem Observatorium.
Eine der dort befindlichen Uhren wurde auf mittlere Göttinger Zeit gestellt. Die Beobachtungstermine waren
vom magnetischen Verein für alle Mitglieder vorgegeben. In einem Circular, das in unserem Archiv vorhanden ist,
wird die Zahl der Termine auf vier festgesetzt und zwar von drei zu drei Monaten, am Ende der Monate
Februar, Mai, August und November. Die Messungen begannen jeweils am Freitag um 22:00 Uhr und endeten am Samstag
ebenfalls um 22:00 Uhr Göttinger mittlerer Zeit.
Die Ablesung am Magnetometer
bewerkstelligte man mit Hilfe eines Beobachtungsfernrohres über einen an der Achse des Magnetstabes
befestigten Spiegel. Der Wert konnte so von einer Skala an der Mauer abgelesen werden. Vorerst befand
sich das Unifilar etwa in der Mitte des Raumes.
Die Resultate der ersten Messungen sind bei Gauss & Weber abgedruckt. Dieses Instrument ist an einem
einfachen Draht aufgehängt und zeigt somit die Änderungen der magnetischen Deklination.
1840 erwarb Koller aus der selben Werkstätte ein zweites Gerät. Dieses war ein sogenanntes Bifilar. Der
14,3 kg schwere Magnetstab war in diesem Fall auf zwei Drähten aufgehängt es konnte damit auch die Intensität
der Abweichung gemessen werden. Das Bifilar wurde jetzt an der Stelle des Unifilars aufgestellt. Das
Unifilar kam an die Stelle, an der es auch heute noch steht. Der Draht, ein versilberter Kupferdraht,
wurde an dem festen Pfosten aus
Lärchenholz befestigt. Im Oktober 1840 erfolgte die erste Messung mit dem neuen Bifilar.
(In Kremsmünster (48° 3' nördl. Breite 14° 8' ostl. Länge von Greenwich) hat Hr. Prof. Koller
im Novembertermin zum ersten Mal die Intensitätsbeobachtungen mit den Declinationsbeobachtungen
verbunden. Gauss, 1840, 166 - Als Personal in Kremsmünster wird angeführt:
In Kremsmünster ausser Hrn. Prof. Koller die HH. Danner,
Fellöcker,
Fuchs,
Haslberger,
Lett[en]mayr und
Reslhuber.
Gauss, 1840, 167)
Bald darauf erkannte man, dass die Messungen im Astronomischen Kabinett nicht besonders präzise ausgeführt
werden konnten, sodass man den Plan fasste, ein eigenes Observatorium im Hofgarten zu
errichten. Im Juni des Jahres 1841 wurde dieser ausgeführt. Mit Anfang des Jahres 1842 begannen
die täglichen Messungen, welche um
08:00, 14:00 und 20:00 Uhr nach mittlerer Göttinger Zeit durchgeführt wurden.
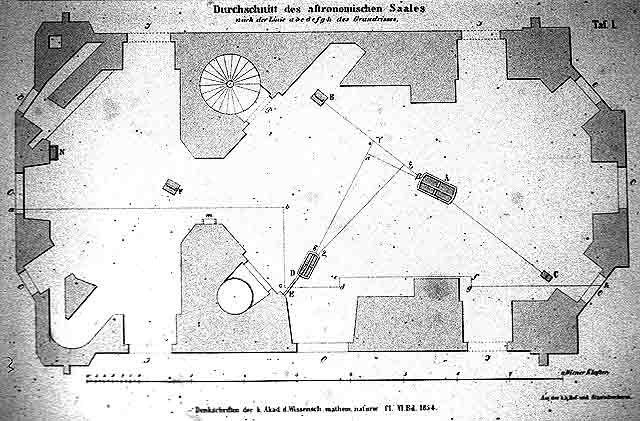
Tafel I aus RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Über das Magnetische
Observatorium in Kremsmünster und die vom
Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, Wien (Repro: 200104020015)
Ein Gauss'sches Unifilarmagnetometer mit vierpfündigem Stabe zur Beobachtung
der Variationen der magnetischen Declination, aufgestellt im grossen Observations-Saale
der Sternwarte am Orte D, Taf. I. Das Magnetometer hängt an einem dünnen versilberten Kupferdrathe von
1° 3' 4" Wien. Mass Länge. Der Aufhängepunkt ist wie bei allen Magnetometern in zwei aufeinander
senkrechten Richtungen verschiebbar. Den Kasten trägt ein vom Bodenpflaster isolirter Pfeiler aus Backsteinen.
Der Spiegel befindet sich nahe am Mittelpunkte des Instrumentes, ist mit dem Schiffchen verbunden, seine
Fläche läuft nahe parallel mit der Axe des Magnetes.
In F befindet sich an einem hölzernen dreifüssigen Stative, das im Fussboden gut befestiget ist, die
Millimeter-Scale 2° 5' 0"44 von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels entfernt; der Werth
eines Theilstriches der Scale sonach = 19"14 im Bogen.

Tafel II, ebenda (Repro: 200104020016)
Die Torsion des Fadens wird möglichst aufgehoben, indem man einen nicht magnetischen Stab in
das Schiffchen einlegt, dem die Richtung des magnetischen Meridians gegeben wird.
(RESLHUBER, Denkschr., 6)
GAUSS, Carl Friedrich & WEBER, Wilhelm, 1839: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins
vom Jahre 1839, Leipzig
GAUSS Carl Friedrich & WEBER, Wilhelm, 1840: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins
vom Jahre 1840, Leipzig
HENTSCHEL, Klaus, 2005: Gaussens unsichtbare Hand. Der Universitäts-Mechanicus und Maschinen-Inspector
Moritz Meyerstein. Ein Instrumentenbauer im 19. Jahrhundert, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen. Mathematisch-Physikalische Klasse. 3. Folge, Göttingen
KOLLER, P. Marian 1842: Bericht über die meteorologischen und magnetischen Beobachtungen,
angestellt auf der Sternwarte in Kremsmünster im Jahre 1841, in: Zeitschrift des Museum Francisco-Carolinum, 1842,
Linz, 42-44, 47-49, 51-53, 59-62, 68-70
KOLLER, P. Marian, 1848: Vorläufige Nachricht von der Beobachtung des Nordlichtes vom 18.
Oktober und gleichzeitiger magnet. Störungen in Kremsmünster (nach einem Brief Reslhubers).
SbKAW m.n.Kl., 1, 530
KRAML, P. Amand 2001: Geschichte der Wetterbeobachtung in Kremsmünster,
Festvortrag anläßlich der Jahresversammlung der
Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, ÖGM-bulletin 2001/1, Wien, 4-10
KRAML, P. Amand 2008: 250 Jahre Sternwarte Kremsmünster, in: Öffentliches Stiftsgymnasium
Kremsmünster 151. Jahresbericht, 33-83, Thalheim
KRAML, P. Amand 2012: 250 Jahre Wetterbeobachtung an der Sternwarte Kremsmünster, in: Öffentliches Stiftsgymnasium
Kremsmünster, 155. Jahresbericht, 33-44
LIZNAR, J., 1879: Magnetische Messungen in Kremsmünster, ausgeführt im Juli 1879. SbKAW m.n.Kl.,
80, Abt.II, 776-784
POGGENDORFF, J. C., 1833: Annalen der Physik und Chemie, 28. Bd., Leipzig
RABENALT, P. Ansgar 1977: 1976 - 1977 - 1978 Briefwechsel von zwei berühmten Männern,
in: Öffentliches Stiftsgymnasium Kremsmünster, 120. Jahresbericht, Wels 183-244
REICH, Karin & ROUSSANOVA, Elena 2016: Der Briefwechsel zwischen Karl Kreil und Alexander von Humboldt,
ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Erdmagnetismus. In: Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien HiN XVII, 33, 50-71
REICH, Karin & ROUSSANOVA, Elena 2018: Karl Kreil und der Erdmagnetismus. Seine Korrespondenz mit Carl Friedrich Gauß im
historischen Kontext, Veröffentlichungen zur Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin, Nr. 68, Wien
RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Die täglichen Beobachtungen der magnetischen Declination und
Horizontal-Intensität, Wien
RESLHUBER, P. Augustin 1854: Über das Magnetische Observatorium in Kremsmünster und die vom Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, in: Denkschriften der math.-naturwiss. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. VI. Wien, 1-56
RESLHUBER, P. Augustin, 1854: Über das Magnetische Observatorium in Kremsmünster und die vom
Jahre 1839-50 aus den Beobachtungen abgeleiteten Resultate, Wien
RESLHUBER, P. Augustin, 1858: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster in den Jahren 1851,
1852, 1853. Mit einem Nachtrag von F. Lukas, JbZAMET 1853, 33-82
RESLHUBER, P. Augustin, 1859: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1854, JbZAMET 1854, 29-42
RESLHUBER, P. Augustin, 1860: Bericht über die im Jahre 1859 auf dem magnetischen Observatorium zu
Kremsmünster beobachteten Störungen, SbKAW m.n.Kl., 42, 221. 533-572
RESLHUBER, P. Augustin, 1860: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1855. Mit einem Nachtrag von
F. LUKAS, JbZAMET 1855, 31-44
RESLHUBER, P. Augustin, 1861: Magnetische Beobachtungen zu Kremsmünster im Jahre 1856. Mit einem Anhange von
F. Lukas, JbZAMET 1856, 31-46